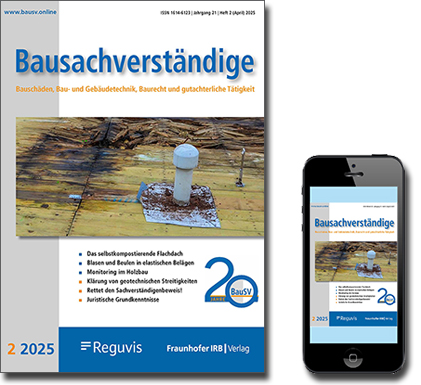BauSV 3/2024
Baubetrieb

Verzug – der gestörte Bauablauf
Was tun, wenn es beim Bauen hakt?
Nach meinem Studium habe ich als Bauleiter bei HOCHTIEF angefangen. Mein Chef hat immer gesagt: »Papendick! Jetzt pass mal gut auf. Du musst jedes Bauprojekt einmal im Kopf von vorne bis hinten, vom Anfang bis zum Abschluss komplett durchlaufen haben. Es ist wichtig, sich den gesamten Bauablauf einmal im Detail vergegenwärtigt zu haben, damit es dich später nicht kalt erwischt.«
Ich bin nun seit 30 Jahren in diesem Beruf und es erwischt mich immer wieder kalt. Immer ist da irgendetwas, das nicht auf meinem Zettel stand. Die Corona-Zeit hat uns gelehrt: Da kann man noch so präzise Terminpläne und wohlformulierte Vertragsstrafen vereinbaren – wenn die Lieferketten für die Wärmepumpe, das Lüftungsgerät oder die Rauchschutztüren unterbrochen sind, dann…. ja was dann? Dann kann man sich auf den Kopf stellen. Die Sachen werden ganz bestimmt nicht pünktlich auf der Baustelle sein. Und seit dieser Zeit hakt es ungewöhnlich oft in der Bauwirtschaft.
Der Verzug
Kennen Sie Grimms Märchen »Sechse kommen durch die ganze Welt«? Ein entlassener und mittelloser Soldat trifft fünf sehr unterschiedlich begabte (und etwas schräge) Zeitgenossen, die gerade deshalb seine Bewunderung auf sich ziehen, weil ein jeder von ihnen etwas Besonderes kann. Da gibt es den Bäumeausreißer, der Bäume ausrupft, »als wären es Kornhalme«, den Frostmacher, den Präzisionsschützen (schießt einer Fliege auf zwei Meilen Entfernung ein Auge aus) und den Bläser, der mit nur einem Nasenloch Windmühlen antreibt und ganze Regimenter nebst Obersten wegblasen kann. Und dann ist da der blitzschnelle Läufer, der ein Bein abschnallen muss, damit er nicht zu schnell wird beim Laufen. Fabelhaft!
Diese Fünfe schließen sich dem Soldaten an, der jeden einzelnen von ihnen aufs herzlichste respektiert. Gemeinsam kommen sie durch die ganze Welt. Am Ende wird der Habenichts – der sich die Begabungen der anderen höflich zunutze macht – ein König sein. »Da brachten die sechs den Reichtum heim, teilten ihn unter sich und lebten vergnügt bis an ihr Ende.« Das Märchen erzählt vom Geheimnis des Führens. Nicht vom arroganten Auftreten anderen gegenüber, von Überheblichkeit, dem Erteilen von Befehlen und dem bedingungslosen Gehorchenmüssen. Es zeigt, dass es gut sein kann, wenn man das Genie und die Begabungen nicht bei sich selbst, sondern immer wieder in anderen sucht, und dass man die Fähigkeiten und Fertigkeiten anderer gewinnbringend – und zwar für alle Beteiligten! – einsetzen kann.
Das kann / sollte auch das Geheimnis einer erfolgreichen Projektleitung und die Basis für das gegenseitige Vertrauen von Auftraggeber / Bauherr und Auftragnehmer sein. So gibt es Bauherren, die bei der Wahl »ihrer« Firmen, Planer und Fachplaner eine so glückliche Hand haben – verbunden mit einem gewissen Gespür für Menschlichkeit –, dass sie stets erfolgreich in der Umsetzung ihrer Projekte sind. Dort, wo andere scheitern, weil sie ihre Forderungen und Ziele mit Druck durchsetzen wollen (ob als Projektleiter oder Auftraggeber), erleben wir den oft zitierten und gefürchteten »gestörten Bauablauf«. Kommt ein Projekt ins Stocken, so ist dies immer mit Kosten und einem nicht unerheblichen Imageverlust verbunden. Nicht selten verhärten sich die Fronten und infolge eines Mangels an Vertrauen ist eine weitere Kommunikation mitunter nur noch mit Rechtsanwälten möglich.
Zu den typischen Bauablaufstörungen gehören Planungsfehler, mangelnde Absprachen / Verträge, Fehler in der Ausschreibung, Bedenkenanmeldungen, Nachträge, Behinderungsanzeigen, Terminverzögerungen, Vertragsstrafen, Bauunterbrechungen durch Behörden, das Ausbleiben von Zahlungen, Kündigungen – und eben auch der Verzug.
Der Begriff des Verzugs wird im Baualltag regelmäßig – und regelmäßig falsch – verwendet. Der Auftragnehmer soll mit der Fertigstellung im Verzug sein, da er den Bauzeitenplan nicht einhält, der Auftraggeber zahlt nicht gleich, also soll auch er sich im Verzug befinden. Aber ganz so einfach ist es mit dem Verzug tatsächlich nicht. Im Gegenteil: Verzug ist ein gesetzlich definierter Begriff, der gerade im Baurecht diverse Voraussetzungen hat.
Zunächst sollen nachfolgend die Voraussetzungen für den Eintritt des Verzugs dargestellt werden. Dabei ist wie so oft zu unterscheiden nach BGB- oder VOB/B-Vertrag. Zu unterscheiden ist außerdem zwischen Verzug des Auftragnehmers und des Auftraggebers. Welche Folgen sich aus dem Verzug für die jeweilige Vertragspartei ergeben können, wird dann der nächste Artikel erläutern.
I. Ansprüche gegen den Auftragnehmer nach VOB/B
Fangen wir mit den Ansprüchen gegen den Auftragnehmer an. Der Auftragnehmer hat eine Bauleistung auszuführen. Manchmal gibt es einen Bauzeitenplan oder Fristen im Vertrag, manchmal aber auch nicht. Wann also gerät der Auftragnehmer mit der Ausführung seiner Leistung in Verzug?
1. Fälligkeit der Leistung
Verzug kann überhaupt immer erst dann eintreten, wenn die geschuldete Leistung fällig ist. Das setzt voraus, dass die Vertragsparteien wissen, wann die Leistung nach dem Vertrag pünktlich zu erbringen gewesen wäre und der Auftragnehmer nach dem Vertrag verbindlich verpflichtet ist, die Leistung zu genau diesem Zeitpunkt zu erbringen. Hierfür sieht die VOB/B eine Regelung in ihrem § 5 vor. Dort wird dann allerdings unter dem Oberbegriff »Ausführungsfristen« zwischen zwei verschiedenen Fristen unterschieden. Zum einen die verbindlichen Vertragsfristen und die (nicht verbindlichen) Einzelfristen.
a. Verbindliche Vertragsfristen
Es sind aber nur die Fristen verbindliche Vertragsfristen, die als solche im Vertrag gekennzeichnet sind. Beispiel: Verbindliche Frist für die Fertigstellung Rohbau: 31.06.2013. Die Überschreitung verbindlicher Vertragsfristen kann sofort Folgen auslösen. Die Bezeichnung als verbindliche Frist sollte dabei möglichst wörtlich in den Vertrag übernommen werden, anderenfalls laufen die Vertragsparteien Gefahr, später darüber zu streiten, ob es sich nun um eine verbindliche Vertragsfrist gehandelt hat oder nur um eine (unverbindliche) Ausführungsfrist.
Den ganzen Beitrag können Sie in der Juni-Ausgabe von »Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.