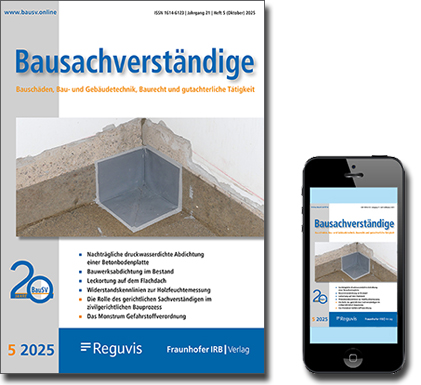Kerbwirkungen − die unterschätzte Schadensursache
Zugspannungen führen zu Putzrissen und Druckspannungen zu Putzablösungen. Das sind die grundsätzlichen Ursachen für Putzschäden. Es kommen aber noch andere Wirkmechanismen hinzu.
Die hygrothermische Beanspruchung von Außenputzen
Die hygrothermischen Beanspruchungen von Außenputzen werden im Tagesrhythmus von Erwärmung und Abkühlung bzw. Befeuchtung und Trocknung bewirkt. Die Beanspruchungen des angrenzenden Mauerwerks sind demgegenüber stark abgeschwächt, abhängig von dessen Dicke und Wärmedämmung. In erster Näherung kann man davon ausgehen, dass in der Außenwand im Tagesablauf keine größeren Formänderungen erfolgen, denn die äußeren Schichten werden von der Masse der Wand gewissermaßen festgehalten.
In der Schemadarstellung Abb. 1 ist im oberen Bereich dargestellt, welche Formänderungen ein Putz bei den genannten Beanspruchungen, getrennt vom Putzgrund, vollziehen würde. Wenn diese Formänderungen wegen festem Kontakt mit dem Putzgrund nicht möglich sind, treten im Putz die im unteren Bereich des Bildes angegebenen Spannungen auf. Das sind bei Erwärmung oder Befeuchtung Druckspannungen und bei Abkühlung oder Trocknung Zugspannungen. Da bei mineralischen Baustoffen allgemein die Zugfestigkeit wesentlich geringer ist als die Druckfestigkeit, sind Risse der häufigste Schaden bei Putzen.
Selbst gleiche Verformungseigenschaften (Wärmedehnkoeffizienten und Schwindmaß) von Putz und Mauerwerk bringen keine Verbesserung, denn unter instationären Verhältnissen sind auch Spannungsrisse bei einheitlichem Material nicht zu vermeiden, wie z. B. von der Oberfläche ausgehende Trocknungsrisse bei Rundholz zeigen. Putzschäden infolge hygrothermischer Beanspruchung treten aber in der Regel in Verbindung mit zusätzlichen Wirkmechanismen auf, das sind bei Zugbelastung Kerbwirkungen und bei Druckbelastung geringe Haftfestigkeit.
Kerbwirkung bei Zugbelastung
Lokale Störungen in einer gleichmäßigen Struktur können als Kerben wirken, welche bei Zugbelastung den Rissverlauf beeinflussen. Zwei Beispiele aus der Praxis: Beispiel 1: Will man ein Blatt Papier ohne Schere teilen, dann faltet man das Blatt, glättet den Falz durch Überstreichen und erhält beim Reißen zwei einzelne Blätter. Durch das Falzen entsteht in der Papierstruktur eine Kerbe, wodurch davon ausgehend eine saubere Teilung möglich ist.
Beispiel 2: Eine Kunststofffolie kann sehr reißfest sein, sodass man diese nicht einfach zerreißen kann. Durch einen kleinen Einschnitt am Rand ist das aber bei gleichem Kraftaufwand möglich. Die aufgebrachte Reißkraft wirkt konzentriert am Einschnitt als Kerbe und ermöglicht eine Teilung. Nach dieser Einführung werden Kerbwirkungen am Bau betrachtet.
Abb. 2 zeigt einen freigelegten Vertikalriss über drei Steinlagen im Außenputz eines Mauerwerks aus Leichtziegeln. In der obersten und untersten Steinlage sind nicht verfüllte Stoßfugen zu erkennen, die den Außenputz zum Reißen gebracht haben sowie auch den Ziegel in der Mittellage. Die Stoßfugen waren wohl nur in Steinmitte vermörtelt, sodass die Steinflanken gewissermaßen »beweglich« waren, weshalb durch Temperaturänderungen oder wegen Druckbelastung Querkräfte entstanden sind. Diese geringen Einwirkungen haben aber offensichtlich gereicht, um als Kerben zu wirken und einen Riss im Putz und sogar im angrenzenden Ziegel hervorzurufen.
Den ganzen Beitrag können Sie in der Dezember-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.