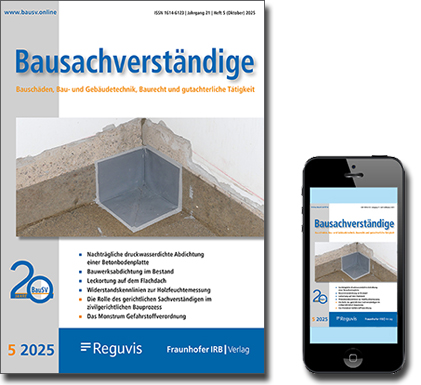BauSV 5/2025
Bautechnik

Wenn das Haus feuchte Füße hat
Bauwerksabdichtung im Bestand – das neue WTA-Merkblatt 4-6 »Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauwerke«
1 Einleitung
Die Mitglieder der WTA-Arbeitsgruppe 4-6 des Referats 4 der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. überarbeiteten das Merkblatt zur nachträglichen Bauwerksabdichtung erdberührter Bauteile. Einen Abgleich mit den neu geregelten Begrifflichkeiten der Normenreihe DIN 18531 bis DIN 18535 und im speziellen der DIN 18533 – Abdichtung von erdberührten Bauteilen – galt es umzusetzen.
Im Fokus standen neben der Anpassung der neu geregelten Definitionen, der Bemessung nachträglicher Abdichtungen erdberührter Bauteile und Bauwerke und der Zuordnung auf die normativen Wassereinwirkungsklassen die Rissklassifizierung und die Überführung der Nutzungsarten des erdberührten Bauteils in den Sprachgebrauch des seit 1998 eingeführten Regelwerks.
Bei der mittlerweile 4. Bearbeitung des WTA-Merkblattes 4-6 »Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile« wurde allen Beteiligten bewusst, dass in allen Bereichen Anpassungen des Merkblattinhalts notwendig waren. Abdichtungsbauweisen, die sich seit der letzten Veröffentlichung zur Abdichtung von erdberührter Wandflächen bewährt hatten, wie z.B. mit Flüssigkunststoff (FLK) und flexibler polymermodifizierter Dickbeschichtung (FPD), wurden als geeignete Abdichtungsbauweisen aufgenommen.
Zwangsläufig mussten die Modifizierung der Systemdarstellungen mit Lage der Abdichtungen sowie die Ausführungsdokumentationen an das Regelwerk für die nachträglichen Bauwerksabdichtungen angepasst werden. Im Detail wurden u.a. Übergänge von raumseitigen Innen- auf erdberührte Außenabdichtungen geregelt, wie sie in der Praxis angewendet, aber bislang nicht umfänglich im Merkblatt beschrieben waren. Dies betraf auch die Abdichtung erdberührter Bodenflächen. Das Regelwerk liegt in deutscher Fassung vom Dezember 2024 vor und wendet sich an Planer, Produkthersteller, Sachverständige und Ausführende.
2 Geltungsbereich
Gegenstand des Merkblattes 4-6 ist die nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile von Wand- und Bodenflächen gegen Wasser und ihre prinzipiellen Detaillösungen in der Bauwerksinstandsetzung und Denkmalpflege mit praxisbewährten Verfahren. Das Regelwerk beinhaltet Hinweise für die objektbezogene Planung und Auswahl der Abdichtungsstoffe. Für die Verwendung von Abdichtungsstoffen gilt, dass diese den bauordnungsrechtlichen Regelungen zur Verwendbarkeit entsprechen müssen. Hinweise zur grundsätzlichen Verarbeitung werden erläutert und darauf verwiesen, dass die Herstellervorgaben einzuhalten sind.
Ziel der nachträglichen Bauwerksabdichtung ist es, objektspezifisch die optimale Nutzung der vorab geschädigten Bausubstanz zu ermöglichen. Die zahlreich im Merkblatt vorhandenen Abbildungen wurden ebenfalls überarbeitet und den Ausführungen angepasst. Die Abbildungen verstehen sich als Prinzipienskizzen und dienen nicht der Detail- oder Ausführungsplanung. Maßnahmen gegen Radon werden im Merkblatt 4-6 nicht geregelt, da diese in der WTA-Arbeitsgruppe »Radon« und in der DIN/TS 18 117 behandelt werden.
3 Grundsätze zur Planung nachträglicher Abdichtungen
Nachträgliche Abdichtungen sind generell zu planen und von außen anzustreben. »Mit der Planung und Auswahl nachträglicher Abdichtungsbauarten ist ein Planer zu beauftragen, andernfalls trägt der Ausführende die technische Planungsverantwortung.« [1] Vorangestellt ist eine Ursachenanalyse der Schäden mittels Untersuchungen.
Der Bemessungswasserstand und die Wassereinwirkungsklasse sind festzulegen. Raumnutzungsklassen und die Bewertung der Rissklasse des Untergrunds sind im Vorfeld zu bestimmen. Die Festlegung der Abdichtungsziele ist ebenso ausschlaggebend für die Auswahl der Abdichtungsbauart. Die objektspezifischen Parameter gilt es zu bewerten und die Planung der nachträglichen Bauwerksabdichtung(en) zu dokumentieren. Die Planung sollte die Abschätzung des Zeitraums bis zum Erreichen des Abdichtungserfolges und die Festlegung der Qualitätskontrolle beinhalten.
Den ganzen Beitrag können Sie in der Oktober-Ausgabe von »Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.