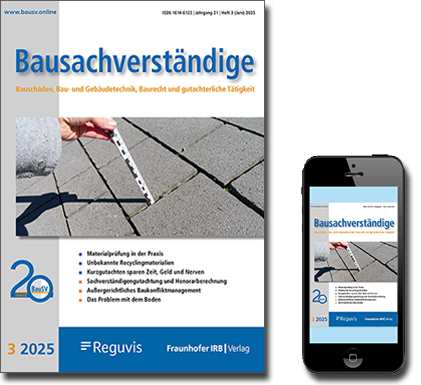- Das Sonderkündigungsrecht nach § 3 Abs. 2 AVBFernwärmeV setzt nicht voraus, dass der Wärmekunde nachweisen muss, dass er auch tatsächlich erneuerbare Energien für die Wärmeerzeugung einsetzt, allein der Wille zum Einsatz von regenerativen Energien muss vorhanden sein. Dafür reicht das konkrete und detaillierte Angebot eines Heizungsbauers aus.
- Die Luft-Wärme-Pumpe stellt eine erneuerbare Energie im Sinne des § 3 Abs. 2 AVBFernwärmeV dar.
Aus den Gründen
Die Parteien streiten u.a. über die Wirksamkeit der Kündigung eines Nahwärmelieferungsvertrags; die Klägerin versorgt das Grundstück des Beklagten über das Nahwärmenetz mit Wärme.
Das Kündigungsrecht des Beklagten ergibt sich vorliegend nicht aus den allgemeinen Versorgungsbedingungen selbst, sondern aus § 3 II der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV). Gem. § 3 II AVBFernwärmeV kann der Kunde eine Kündigung des Versorgungsvertrages mit zweimonatiger Frist vornehmen, sofern er die Leistung durch den Einsatz erneuerbarer Energien ersetzen will. Er hat zu belegen, dass erneuerbare Energien eingesetzt werden.
Der Beklagte begründete die Kündigung damit, dass er seine Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Energien umstellen wolle. Bis zum Ablauf des Kündigungsdatums werde in das Anwesen eine Luft-Wärme-Pumpen-Technik eingebaut, die zunächst mit Ökostrom, dann mit Strom aus einer hauseigenen Photovoltaikanlage betrieben werden solle. Dieses Vorhaben wurde auch mit einem Angebot des Heizungsbauers ausreichend belegt; die geplante Nutzung von Ökostrom wurde nicht bestritten.
Das Gesetz sieht nicht vor, dass der Kunde nachweisen muss, dass er auch tatsächlich erneuerbare Energien für die Wärmeerzeugung einsetzt, allein der Wille zum Einsatz von regenerativen Energien muss vorhanden sein. Wie substantiiert der Plan sein muss und in welchem Umfang hier eine Prüfung durch die Versorger durchgeführt werden darf, werden die Gerichte herausarbeiten müssen.
Nach Auffassung des Gerichts muss das konkrete und detaillierte Angebot des Heizungsbauers dafür ausreichen; die geplante Nutzung von Ökostrom wird nicht bestritten. Das Angebot / Gesamtkonzept kann dann das Versorgungsunternehmen auf Plausibilität prüfen. Weitergehende Nachweispflichten oder gar der Beginn des Umbaus können nicht verlangt werden, da der Anschlussnehmer grundsätzlich keine Einwirkungsmöglichkeit auf den Hausanschluss hat, § 10 Abs. 4 S. 5 AVBFernwärmeV.
Sollte der Beklagte nach der Kündigung doch keine Luft-Wärme-Pumpe einbauen, sondern weiter Energie von der Klägerin ziehen, würde das Vertragsverhältnis konkludent und einvernehmlich fortgesetzt. Sollte er andere Energieformen heranziehen, könnte er auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, denn dann wäre sein Wille zum Einsatz erneuerbarer Energien nur vorgetäuscht gewesen. Hier sieht das Gericht Parallelen zur Rechtslage bei der Kündigung von Wohnraum aufgrund Eigenbedarfs. Auch hier muss der zukünftige Nutzungswille belegt werden; sollte der Eigenbedarf dann nicht ausgeübt werden, kommen Schadensersatzansprüche wegen vorgetäuschten Bedarfs in Betracht. Die Rechtsordnung kennt also solche Konstellationen.
Die Luft-Wärme-Pumpe stellt eine erneuerbare Energie im Sinne des § 3 II AVBFernwärmeV dar.
Zwar wird diese Art der Energiegewinnung nicht ausdrücklich im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) genannt, es handelt sich dabei allerdings um ein redaktionelles Versehen des Gesetzgebers. Dies lässt sich aus der Vergleichbarkeit der Geothermie, die in § 3 Nr. 21 lit. d als erneuerbare Energie bezeichnet wird, zur Umweltthermie folgern. Beide Arten der Wärmegewinnung beziehen die Wärme aus der Umwelt und benötigen für ihre Funktion Strom.
Darüber hinaus findet sich die Umweltwärme neben der Geothermie als erneuerbare Energie auch in § 3 II Nr. 2 des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG). Das GEG beruht auf der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.05.2010. Auch darin wird nach Art. 2 Nr. 6 die aerothermische Energie als Energie aus erneuerbaren, nicht fossilen Energiequellen bezeichnet.
Dem steht auch nicht der Umstand entgegen, dass die Luft-Wärme-Pumpen-Technik, nach Aussage der Klägerin, energetisch schlechter sei als die Nahwärmeversorgung. Dem nationalen Gesetzgeber wurde im Rahmen des Art. 24 III der Richtlinie 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen ein Umsetzungsspielraum eingeräumt, wonach er die Kündigung nach Absatz 2 auf die Kunden beschränken kann, die belegen können, dass die geplante alternative Lösung für die Wärme- bzw. Kälteversorgung zu wesentlich besseren Ergebnissen bei der Gesamtenergieeffizienz führt.
Dies wurde jedoch vom deutschen Gesetzgeber nicht umgesetzt, sodass es insoweit nicht auf die Gesamtenergieeffizienz ankommt. Da sich der Gesetzgeber entsprechend entscheiden durfte, kommt eine Vorlagefrage nicht in Betracht. Es steht erkennbar der gesetzgeberische Gedanke im Vordergrund, die Klimaschutzziele gem. § 3 Klimaschutzgesetz (KSG) zu erreichen, indem die Treibhausgasemissionen schrittweise gemindert werden. Dieser Gedanke beruht auf den europarechtlichen Zielen, die durch die Verordnung 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris festgesetzt wurden.
Eine Wärmepumpe zieht bis zu 80% der benötigten Energie aus der Umwelt. Wird der für die Funktion der Luft-Wärme-Pumpe benötigte Strom ebenfalls aus erneuerbaren Energien gewonnen, in Form von »Ökostrom«, führt dies zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, sodass dadurch dem Willen des europäischen Gesetzgebers, der sich aus dieser verbindlichen Verordnung ergibt, entsprochen wird. So wurde auch die Wärmeenergie bei Nutztemperatur, die mithilfe von Wärmepumpen, die für ihren Betrieb Elektrizität oder andere Hilfsenergie benötigen, nach Verordnung 2022/132 der Kommission vom 28. Januar 2022 zur Änderung der Verordnung Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Energiestatistik hinsichtlich der Durchführung von Aktualisierungen für die jährlichen, monatlichen und monatlich zu übermittelnden kurzfristigen Energiestatistiken nach Ziff. 3.5.9 als Erneuerbare Energiequelle eingestuft.
Nicht zuletzt ist die Verwendung von Ökostrom auch z.B. bei der Förderung von Wallboxen zum Aufladen von Elektroautos zur Voraussetzung gemacht worden. Dies zeigt auch, dass die Verwendung von Ökostrom gefördert werden soll, insbesondere Ökostrom von zertifizierten Anbietern, die diesen tatsächlich aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraft gewinnen.
§ 3 II AVBFernwärmeV ist auch anwendbar auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novellierung bestehende Vertragsverhältnisse. Gemäß § 1 I AVBFernwärmeV werden die §§ 2–34 AVBFernwärmeV dabei in der jeweils gültigen Fassung Bestandteil des Versorgungsvertrags, soweit – wie hier – ein Fernwärmeversorgungsunternehmen für den Anschluss an die Fernwärmeversorgung und die Versorgung mit Fernwärme Vertragsmuster oder Vertragsbedingungen verwendet, die für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind (Allgemeine Versorgungsbedingungen).
LG Regensburg, Urteil vom 8.7.2022, Az. 34 O 2572/2
Als Premiumabonnent von »Der Bausachverständige« haben Sie Zugang zur Recherche in unserer Rechtsprechungsdatenbank.