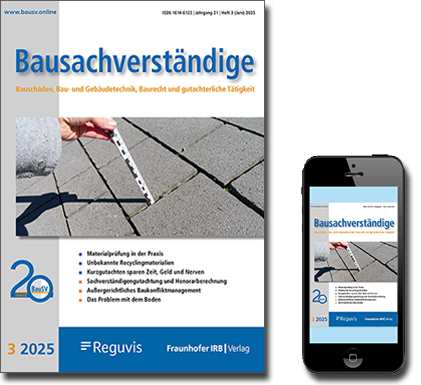In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass Sachverständige bei einer Vielzahl von Regelwerken oder fast ohne detaillierte Regelwerke eine Entscheidung über die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst treffen müssen. Dabei ist jeweils Vorsicht geboten. Häufig bieten verschiedene Kreise eigene technische Merkblätter, Richtlinien oder andere Regelwerke an. Beispielhaft sind hier nur die Regelungen der RAL Gütegemeinschaften oder des Bundesverbands Flachglas e.V. genannt. In einer solchen Konstellation müssen Sachverständige stets überprüfen, ob diese Richtlinien tatsächlich die allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst treffend wiedergeben.
Nicht jedes geschriebene Regelwerk ist eine allgemein anerkannte Regel der Technik
Grundsätzlicher Ansatzpunkt ist dabei immer die Bestimmung der a.a.R.d.T. Nach Auffassung des BVerwG sind darunter Prinzipien und Lösungen zu verstehen, die wissenschaftlich als richtig anerkannt und in der Praxis erprobt und bewährt seien. Weiterhin müssen sich die Prinzipien und Lösungen bei der Mehrheit von Praktikern durchgesetzt haben.
Unrichtig ist dabei die landläufige Meinung, dass eine Kodifizierung von Regelwerken zugleich eine tatsächliche Vermutung für die Darstellung der a.a.R.d.T. in dem Regelwerk begründet. Diese Auffassung geht auf die zitierte Entscheidung des BVerwG zurück. In dieser Entscheidung bezog sich das BVerwG allerdings explizit auf die in besonderen Verfahren erstellten DIN-Normen. Zu anderen Regelwerke wurde darin keine Aussage getroffen.
Die Entscheidung beschränkt die tatsächliche Vermutung lediglich auf die DIN-Normen. Zu Recht muss allerdings angemerkt werden, dass neben den DIN-Normen auch andere Regelwerke gleichrangig berücksichtigt werden können. Hier ist allerdings zu fordern, dass der Erstellungsprozess dem der Normentstehung von DIN-Normen gleichwertig sein muss.
Herstellerrichtlinien sind davon jedoch nicht betroffen. Bei diesen handelt es sich letztlich um eine Art der Produktbeschreibung, die häufig eine Beschaffenheitsvereinbarung oder haftungsbeschränkende Elemente enthalten. Eine Herstellerrichtlinie kann daher die a.a.R.d.T. wiedergeben, dahinter zurückbleiben oder darüber hinausgehen. Aufgrund der Einseitigkeit des Erstellungsprozesses kommt diesen Richtlinien keine tatsächliche Vermutungswirkung für die Abbildung der a.a.R.d.T. zu.
Die gegenteilige Auffassung des OLG Jena überzeugt nicht. Danach soll sich auch aus dem Verstoß gegen Herstellerrichtlinien in Abwesenheit sonstiger a.a.R.d.T. eine Vermutung für einen Mangel ergeben. Dies wird mit der tatsächlichen Risikoungewissheit begründet, weil Herstellervorgaben grundsätzlich einzuhalten seien.
Zunächst überzeugt die Vermutung eines Mangels bereits systematisch nicht, weil die Frage der Mangelhaftigkeit von der technischen Frage zur Einhaltung der a.a.R.d.T. zu trennen ist. Die Entscheidung verkennt auch, dass Herstellerrichtlinien im Eigeninteresse des Herstellers auf das Absatzverhältnis gegenüber dem Auftragnehmer ausgelegt sind. Auf die Beziehung des Auftragnehmers zum Auftraggeber sind diese Regelungen nicht abgestimmt.
Die teilweise vertretene Auffassung, Herstellerrichtlinien seien nur bei fehlender DIN-Normung heranzuziehen, ist inkonsequent. Die fehlende Gleichwertigkeit der Herstellerrichtlinien mit technischen Regelwerken wird nämlich offen eingeräumt. Irgendwelche schriftlichen Regelwerke sind nicht besser als eine umfassende Darstellung des Standes der Technik durch den Sachverständigen.
Die gegenteiligen Auffassungen setzen überdies einen Fehlanreiz hin zu immer mehr Herstellerrichtlinien. Der Hersteller kann durch solche Richtlinien die Haftung im eigenen Verhältnis vermeiden. Gleichzeitig erweist er dem Auftragnehmer einen Bärendienst.
Darüber hinaus konterkariert die Annahme einer tatsächlichen Vermutung eines Mangels oder eines Verstoßes gegen die a.a.R.d.T. die grundsätzlichen beweisrechtlichen Wertungen des Werkrechts zur Mangelfreiheit. Sofern keine anerkannte Regel der Technik ermittelt werden kann und das Werk nicht aus sonstigen Gründen mangelhaft ist, ergeht eine Beweislastentscheidung.
Den ganzen Beitrag können Sie in der August-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.