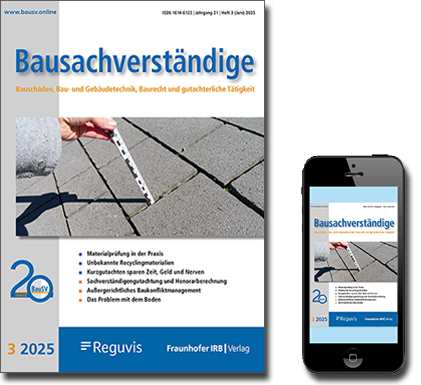Rechtliche Grenzen und Stolpersteine
Der Beitrag stellt rechtliche Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) durch Sachverständige dar und gibt hierzu Handlungsempfehlungen.
Im Bereich der Sachverständigenarbeit eröffnen sich durch den Einsatz von KI-Systemen neue Möglichkeiten, die Effizienz und Präzision der Gutachtenerstellung zu verbessern. Die Verpflichtung zur persönlichen Gutachtenerstellung, wie sie in § 407a Abs. 3 ZPO festgelegt ist, erfordert eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle von KI im Begutachtungsprozess.
Zudem sind Datenschutzbestimmungen zu beachten. Da der Einsatz von KI in der Gutachtenerstellung eine Innovation ist, auf die weder gesetzliche Regelungen noch die einschlägige Rechtsprechung explizit eingehen, muss die rechtliche Einordnung auf Grundlage der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
1. Eigenverantwortlichkeit und Verpflichtung zur persönlichen Gutachtenerstellung § 407a Abs. 3 ZPO
Heute greifen Sachverständige regelmäßig auf die Vorarbeit von qualifizierten Mitarbeitern zurück. Doch können die hierfür bestehenden rechtlichen Werkzeuge auf KI-Systeme übertragen werden?
a) Unerlaubte vollständige Übertragung der Gutachtenerstellung nach § 407a Abs. 3 S. 1 ZPO
Da der Sachverständige sein Gutachten eigenverantwortlich zu erstatten hat, ist es nicht ausreichend, wenn er das Untersuchungsergebnis eines anderen nur unterschreibt oder sich damit einverstanden erklärt. [1] Fraglich ist, ob ein KI-System als »anderer« im Sinne des § 407a Abs. 3 Satz 1 ZPO oder als »Person« nach § 407a Abs. 3 Satz 2 ZPO sein könnte. Eine vollständige Übertragung der Gutachtenerstellung auf eine KI ist mit der oben zitierten Rechtsprechung, d.h. in Form eines bloßen Unterzeichnens, unzulässig:
»Ein Sachverständigengutachten ist nicht verwertbar, wenn es nicht der bestellte Sachverständige selbst ausgearbeitet hat; es genügt nicht, daß er die Verantwortung durch seine Unterschrift übernimmt. Ein Sachverständiger kann Hilfskräfte hinzuziehen, wenn es sich um Tätigkeiten untergeordneter Bedeutung nach Weisung und unter Aufsicht des Sachverständigen handelt und der Sachverständige den wissenschaftlichen Befund selbst feststellt.« [2]
Im Fokus stehen hier also die selbstständige Analyse und Bewertung durch den bestellten Sachverständigen. Fehlt sie vollständig, ist das Gutachten nicht zuzulassen – unabhängig davon, ob das Gutachten von einem anderen Mitarbeiter oder einer KI erstellt wurde.
b) Hilfsdienste untergeordneter Bedeutung nach § 407a Abs. 3 S. 2 Halbsatz 2 ZPO
Das OLG Frankfurt hat damit zusätzlich klargestellt, dass reine Nebentätigkeiten im Sinne des § 407a Abs. 3 S. 2 ZPO für die Frage der selbstständigen und eigenverantwortlichen Gutachtenerstellung irrelevant sind. Zu den klassischen Nebentätigkeiten zählen dabei Hilfsdienste und Schreibarbeiten. [3] Eine KI kann unter Hilfsdienste subsumiert werden, während ihr auch Schreibarbeiten übertragen werden können. Beschränkt sich die Hinzuziehung von KI-Systemen also auf reine Verschriftlichung oder Wiedergabe von Untersuchungsergebnissen des Sachverständigen, ist dies also für die Zulässigkeit des Gutachtens unschädlich. Das Problem der Benennung als Hilfsperson stellt sich damit ebenso wenig.
c) Anzugebende Mitarbeiter nach § 407a Abs. 3 Satz 2 1. Halbsatz ZPO
Problematischer ist es, wenn der Sachverständige, unter Eigenverantwortung, der KI über Schreibarbeiten hinausgehende Aufgaben überträgt, zu denken ist an Subsumtion der vorgefundenen Zustände unter (DIN)-Normen Ergebnisse wissenschaftlicher Studien und Sachverhaltsanalyse.
»Dass der gerichtlich bestellte Sachverständige sich den Entwurf eines Gutachtens durch einen Dritten zuarbeiten lässt, verstößt nicht gegen seine Pflicht zur persönlichen Gutachtenerstattung, wenn er sich diesen Entwurf erkennbar zu eigen macht und dies gegenüber dem Gericht nach außen dokumentiert.« [4]
Zwar ist die wissenschaftliche Auswertung der Arbeitsergebnisse dem Sachverständigen vorbehalten. Dieser Eigenverantwortung ist jedoch schon dann Genüge getan – im Gegensatz zu einer bloßen Freizeichnung – wenn der Sachverständige in hinreichendem Maß erklärt, dass er die Auswertung selbst fachlich nachvollzogen hat und sich zu eigen macht. [5] Bedient sich der Sachverständige also einer KI für eine fachliche Analyse, ist die Bedeutung dieser Zuarbeit nicht mehr untergeordnet.
Ein Gehilfe, dessen Beitrag für die Erstellung des Gutachtens von nicht untergeordneter Bedeutung ist, muss gemäß § 407a Abs. 3 Satz 2 ZPO unter Angabe des Umfangs seiner Mitwirkung, der beruflichen Ausbildung und Stellung namhaft gemacht werden, damit eine Überprüfung seiner Sachkunde ermöglicht wird. [6] In dem vom OLG Köln entschiedenen Fall (a.a.O.) wurden zum Gutachten eines Chefarztes folgende Angaben zur Mitarbeit eines Facharztes als genügend bestätigt:
»Der Sachverständige hat den Kläger persönlich untersucht und hat anschließend das Gutachten gemeinsam mit Dr. E, der ausweislich seiner Unterschrift unter dem schriftlichen Gutachten und seiner Angaben im Verhandlungstermin die Facharztqualifikation besitzt und keinesfalls nur Assistenzarzt ist, entworfen und durch seine Unterschrift selbst verantwortet.«
An dieser Stelle entsteht bei Verwendung von KI-Unterstützung von nicht mehr untergeordnetem Umfang ein Problem:
Die Zuarbeit wird von einem KI-Programm erstellt. Dieses entspricht nicht der mit dem Wortlaut des § 407a Abs. 3 Satz 2 1. Halbsatz ZPO geforderten Eigenschaft als »Person« und verfügt nicht über eine qualifizierende Berufsausbildung.
Den ganzen Beitrag können Sie in der Dezember-Ausgabe von »Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.