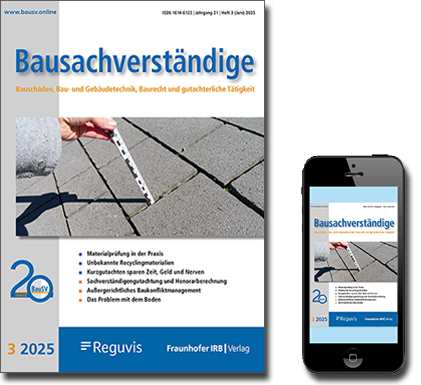BauSV 3/2025
Bautechnik

Fachwerkforschung vor Ort liefert gesicherte Erkenntnisse
Was wir von den Alten lernen können
Es gab zur Sanierung von Fachwerkgebäuden ein Forschungsprojekt, das bis heute ein Alleinstellungsmerkmal hat: Dieses zehnjährige »Verbundforschungsprojekt« der 1980er- und 1990er-Jahre war bisher das einzige Mal, in dem Bauphysiker und Denkmalpfleger gemeinsam nach Lösungen suchten, um Wärme- und Feuchteschutz bei der Fachwerksanierung unter einen Hut zu bekommen. Dies geschah nicht am grünen Tisch, sondern in der Praxis in einem Versuchsgebäude auf der Freilandversuchsstelle des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP in Holzkirchen und an drei real genutzten Gebäuden, die im Freilichtmuseum im Hessenpark wiederaufgebaut wurden (Abb. 1).
Leider müssen wir heute feststellen, dass die dort gewonnenen Erkenntnisse immer noch vielfach missachtet werden, was Bauschäden an der schützenswerten historischen Substanz vorprogrammiert. Dieses Projekt war die letzte große Aufgabe, die mein bauphysikalischer Lehrmeister Helmut Künzel in seiner Dienstzeit bearbeitete. Da er aber auch im Unruhestand seine Erfahrungen erweiterte und in großartigen Fachbüchern im Fraunhofer IRB Verlag publizierte, blieb ich mit ihm als Lektor für Artikel in der Fachzeitschrift »HOLZBAU – die neue quadriga« immer in Verbindung und holte mir seinen Rat, gerade wenn es z.B. um Konstruktionsdetails zur Fachwerksanierung ging.
Deshalb fasste ich für eine Veröffentlichung in dieser Zeitschrift einige seiner wesentlichen Erkenntnisse zusammen, ergänzte sie mit Bildmaterial aus meiner langjährigen Beschäftigung mit dem Thema und dankte ihm für das kritische Gegenlesen, kurz vor seinem 98. Geburtstag im September 2024. Für diese Veröffentlichung habe ich ein Kapitel über hygrothermische Simulation bei Innendämmung auf Basis der WTA-Merkblätter, an denen ich beteiligt war, ergänzt.
Auf den Schlagregen kommt es an
Fachwerkhäuser lösten schon im Mittelalter das entscheidende Problem beim Bauen von Häusern für das »gemeine Volk«: das Transportproblem. Die Baustoffe waren vor Ort vorhanden und benötigten allenfalls Pferdefuhrwerke zur Anlieferung. Die Materialien für die Ausfachungen (Stakungen, Lehm etc.) erlaubten ein hohes Maß an Eigenleistungen der Bauherren.
Holz ist ein dauerhafter Baustoff, der über Jahrhunderte seine Funktion als Tragwerk erfüllen kann, wenn er trocken bleibt. Holz dem Regen auszusetzen, ist das größte Risiko, das man ihm antun kann, was aber bei Sichtfachwerk nicht völlig zu vermeiden ist. Deshalb war die besonders resistente Holzart Eiche überall, wo sie verfügbar war, eine wesentliche Voraussetzung für das Überleben des Bauwerks – aber keine Garantie. Da Regenereignisse hierzulande meist mit Tiefdruckgebieten einhergehen, die westliche Winde übers Land treiben, ist die Orientierung der Fassaden entscheidend für die Schlagregenbelastung.
Aus den Messungen beim zuvor beschriebenen Forschungsvorhaben wurden aus den Beanspruchungsgruppen (SRG) der DIN 4108-3 für Sichtfachwerke Grenzwerte ermittelt, wie viel Schlagregen zuträglich ist. In der SRG I (bis 600 mm/a = 600 l/m2a Normalregen) ergibt sich bei durchschnittlich 25% Schlagregen für Wetterseiten, dass die Beanspruchung maximal 150 l/m2a betragen sollte (weißer Bereich in Abb. 2). Da dies aber große Teile des Landes ausschließen würde, in denen typischerweise Fachwerkhäuser ohne bekleidete oder verputzte Fassaden – auch an Wetterseiten – seit langer Zeit existieren, hatten die Forscher eine Beanspruchungsgruppe I g definiert.
Das »g« steht für geschützt und erfordert eine Standortanalyse, welche die topologische Lage des Objekts, die schützenden Effekte von Nachbarbebauung und den konstruktiven Wetterschutz sachverständig beurteilt. Dies sollte auch berücksichtigen, dass an Wetterseiten bis zu 40% des Normalregens auf die Fassade treffen können (Abb. 3). Das ist der Grund dafür, warum von alters her bei vielen Fachwerken die Giebeldreiecke und Obergeschosse bei westlicher Orientierung verschalt wurden (Abb. 4).
Aufgrund der Verwirbelung der Windanströmung an Gebäudeecken können diese je nach örtlichen Gegebenheiten auch ähnlich stark mit Schlagregen belastet werden wie die Giebeldreiecke. Dies kann sich auch um die Kante herum auf die benachbarten Fassaden auswirken (Abb. 5). Eine solide Lösung mit Außendämmung an der Wetterseite zeigt das condetti-Detail in »HOLZBAU – die neue quadriga«, Heft 2/2008.
Im Zuge der Sanierung eine existierende Vorhangfassade zu entfernen, um das »schöne« Fachwerk sichtbar zu machen, ist das größte Risiko, dem man die historische Baukonstruktion aussetzen kann.
Dies war auch eine der erschreckenden Erfahrungen beim Projekt im Hessenpark, wo nach acht Jahren die exponierten Wetterseiten eine Vorhangfassade erhielten (Abb. 6). Nähere Informationen zur Beurteilung der Bauschäden nach 35 Jahren Nutzung erhielt man anhand von Bauteilöffnungen im Rahmen des neuen Forschungsvorhabens »Fachwerk_2.0« [1].
Den ganzen Beitrag können Sie in der Juni-Ausgabe von »Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.