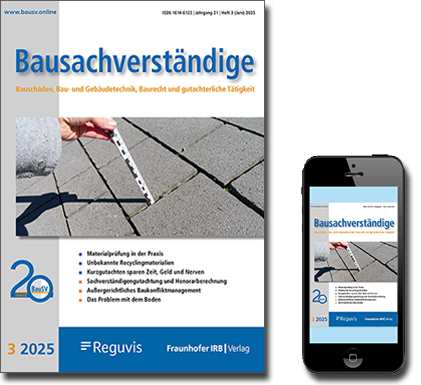Beispiel Technische Gebäudeausrüstung
1 Übersicht
Aufgabe der technischen Gebäudeausrüstung ist es, Funktionen in Gebäuden sicherzustellen (z.B. Beheizung und Kühlung). Die Wirksamkeit ist auch vom Nutzerverhalten und Anspruch der Nutzer abhängig. Für eine Reihe von Komfortkriterien (z.B. Raumtemperatur oder Zugrisiko) lässt sich wissenschaftlich in Abhängigkeit des Nutzerverhaltens und der Konstruktion der technischen Gebäudeausrüstung die Akzeptanz beim Nutzer vorhersagen.
Hierzu werden die Größen PPD (predicted percentage of dissatisfied) oder PD (percentage of dissatiesfied) eingesetzt. Diese Komfortkriterien eignen sich insbesondere als Vertragsgrundlagen für den einzuhaltenden Komfort in Neubauten. Daneben gibt es andere Komfortkriterien, die ohne wissenschaftlichen Bezug willkürlich festgelegt wurden (z.B. Trinkwassererwärmung, Schallschutz und elektrische Ausstattung).
2 Willkürlich festgelegte Komfortkriterien
Zu den willkürlich festgelegten Komfortkriterien gehören die Kriterien an die Trinkwassererwärmung von Wohnungen. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die normativ geregelten Größen. In der Anlage sind die Vorgaben für Duschwannen, Waschtische, Küchenspülen und Badewannen zusammengefasst. In vergleichbarer Weise, also willkürlich ohne wissenschaftliche Untersuchung, regelt VDI 4100 den Schallschutz in Wohnungen.
3 Wissenschaftlich abgeleitete Komfortkriterien
Die wissenschaftlich abgeleiteten Komfortkriterien beziehen sich auf die thermische Behaglichkeit und gehen auf die Dissertation von Ole Fanger zurück [1]. Seit 1995 sind sie Gegenstand internationaler Normung durch DIN EN ISO 7730. DIN EN ISO 7726 regelt die zur Messung des thermischen Komforts geeigneten Messgeräte. Dabei wird die Wirkung einer Heizungsanlage, Klimaanlage o.Ä. im Hinblick auf die Unzufriedenheit eines Nutzers bewertet.
Grundlage ist dabei eine Wärmebilanz zum menschlichen Körper. In diese Wärmebilanz gehen die Aktivität, die Bekleidung, die Lufttemperatur, die Strahlungstemperatur, die Beladung der Luft mit Wasserdampf und die Geschwindigkeit der Raumluftströmung (Mittelwert und Turbulenzgrad) ein. Tabelle 2 gibt einen Überblick über einzelne Komfortkriterien. Optimaler thermischer Komfort liegt dann vor, wenn sich der menschliche Körper in Neutralität befindet, d.h. die Wärmeproduktion muss dem Wert der Wärmeabgabe entsprechen. Bei einer größeren (kleineren) Wärmeproduktion als der Wärmeabgabe, würde das thermische Raumklima als zu warm (zu kalt) empfunden werden.
4 Sind Komfortkriterien allgemein anerkannte Regeln der Technik?
Willkürlich festgesetzte Komfortkriterien können keine allgemein anerkannte Regel der Technik darstellen. Es fehlt an der Eingangsvoraussetzung der theoretischen Korrektheit. Dies sei an folgenden Beispielen erläutert:
- Die Anzahl der für ein Zimmer oder eine Wohnung vorzusehenden Steckdosen ist abhängig von der individuellen Nutzung. Der vermehrte Einsatz mobiler, mit Batterien oder Akkus betriebener elektrischer Geräte wird die Anzahl der tatsächlich benötigten Steckdosen in Teilen einer Wohnung herab- und in anderen Teilen heraufsetzen.
- Die Entnahmemenge für Trinkwasser warm ist nicht nur komfortabhängig. So wird für das Waschen längerer Haare einfach mehr Zeit als für das Waschen kurzer Haare benötigt.
- Die Ausstoßzeit nach VDI 6003 von 60 s für niedrige Komfortansprüche steht im Widerspruch zu einer allgemein anerkannten Regel der Technik. DIN 1988-200 und VDI 6023 fordern eine Mindesttemperatur von 55 °C nach 30 s für Großanlagen (Speicher-Trinkwassererwärmer in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen und Trinkwassererwärmer nach dem Durchflussprinzip mit einem nachgeschalteten Leitungsinhalt von 3 l). Diese Forderung ist theoretisch korrekt, weil sich bei einer niedrigeren Entnahmetemperatur örtlich in den warmgehenden Trinkwasserinstallationen Temperaturen einstellen können, die eine Erhöhung der Keimkonzentration begünstigen. Hierzu gehören die Zirkulationsleitung und der untere Bereich des Speicher-Trinkwassererwärmers. Der Inhalt von DIN 1988-200 und VDI 6023 wird seit 1998 über ein deutschlandweites System von Schulungen der Fachwelt nähergebracht. Die dabei erworbene und durch eine Prüfung nachgewiesene Qualifikation stellt eine Eingangsvoraussetzung für eine Tätigkeit im Bereich Sanitärtechnik dar.
- Temperaturschwankungen von ± 5 K bei der Entnahme von Mischwasser oder Trinkwasser warm (niedrige Komfortansprüche) sind in Bezug auf die Nutzung eines Waschtisches, einer Badewanne oder einer Küchenspüle unkritisch. Bei der Badewannennutzung wird man eine Temperaturschwankung nicht einmal bemerken; es stellt sich dann die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Kriteriums. Anders verhält es sich bei Temperaturschwankungen in geschlossenen Duschkabinen. Bei einer mittleren Entnahmetemperatur von 42 °C und einer für niedrige Temperaturschwankungen zugelassenen Abweichung von ± 5 K beträgt die plötzlich z.B. als Folge von Druckschwankungen auftretende maximal zulässige Temperatur 47 °C. Bei Temperaturen unter 45 °C sind bereits Gewebeschäden möglich. Ab 45 °C tritt der Zelltod bei längerer Exposition ein. Unabhängig davon besteht die Gefahr, dass ältere oder junge Menschen erschrecken und sich verletzen können. Das Kriterium nach einer maximal zulässigen Temperaturschwankung von ± 5 K ist im Falle einer Badewanne irrelevant, würde jedoch im Falle einer Duschwanne eine zu große und möglicherweise gefährliche Temperaturabweichung bedeuten.
Den ganzen Beitrag können Sie in der Juni-Ausgabe von »Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.