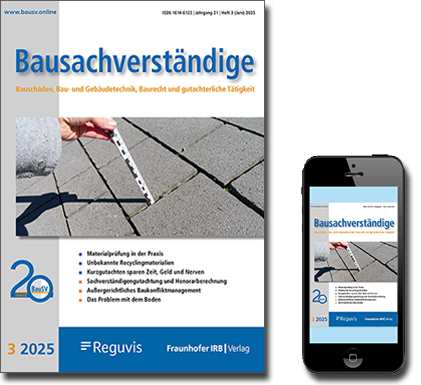BauSV 3/2023
Messtechnik

Mikrobiologische Analysen nach Feuchteschäden
Die Probennahme ist der Flaschenhals auf dem Weg zu einem gesicherten Ergebnis
Schimmelpilzsporen gehören zu den Mikroorganismen und sind überall in unserer Umgebungsluft zu finden. Es wäre naiv zu glauben, man könne einen schimmelpilzfreien Bereich schaffen, von Reinräumen einmal abgesehen. Der Eintrag von Feuchtigkeit in Räume kann jedoch eine stärkere Belastung durch Schimmelpilze verursachen. Die Gründe für Feuchtigkeit und damit das Wachstum von Schimmelpilzen in Innenräumen sind mannigfaltig. Das Ziel aller Beteiligten an der Aufarbeitung eines solchen Schadens muss immer die dauerhafte Entfernung der Schimmelpilze und damit die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Einbauten und des Raumklimas sein.
Vor Beginn einer Sanierung müssen die Ursache für die Feuchtigkeit sowie das Ausmaß des Schadens genau ermittelt werden. Schimmelpilze müssen auf alle Fälle entfernt werden. Dennoch gibt es hier qualitative Unterschiede. Manche Schimmelpilze richten insbesondere wirtschaftlichen Schaden an, andere können unter Umständen gesundheitsgefährdend sein. Auch das sollte bei der Sanierung berücksichtig werden. Letztlich hängt ein möglicher gesundheitlicher Effekt immer vom individuellen Status des Immunsystems der Betroffenen ab. Die häufig gestellte Frage zu einem unteren Schwellen- oder Warnwert muss unbeantwortet bleiben. Es gibt hierzu keine allgemeingültigen Grenzen, was wieder mit der Individualität des Immunsystems und der eigenen Konstitution zu tun hat.
Während dem einen ein belasteter Raum mit Schimmelpilzen nichts anhaben kann, kann ein anderer derart empfindlich darauf reagieren, dass bereits wenige Sporen zu einer körperlichen Reaktion führen können, ähnlich der allergischen Reaktion bei Lebensmitteln. Am Beispiel Haselnüsse lässt sich zeigen, dass die meisten Menschen darauf nicht allergisch reagieren, einige Allergiker sogar eine gewisse Toleranzgrenze aufweisen. Wieder andere können aber bereits bei geringsten Mengen einen anaphylaktischen Schock erleiden. Insofern ist es weder bei Lebensmitteln noch bei Schimmelpilzen möglich, tatsächlich einen unteren Wert zu definieren.
Nichtsdestotrotz sollen Schimmelpilze natürlich bei einer Sanierung entfernt werden. Bei einer gut ausgeführten Sanierung sollte auch die physikalische Entfernung der Sporen mitberücksichtigt werden. Während kleinere Flächen von weniger als 25 cm2 noch gut oberflächlich behandelt werden können, müssen bei größeren Schäden oft Materialien ausgebaut werden. Häufig kommen bei größeren Feuchteschäden dann auch Trocknungsgeräte zum Einsatz. Dabei ist zu bedenken, dass sich Schimmelpilze unter günstigen Bedingungen, wie sie gerade am Beginn der Trocknung noch herrschen, wenn also noch viel Feuchtigkeit vorhanden ist, innerhalb kurzer Zeit weiter ausbreiten können. Anders gesagt: Schimmelpilze können schneller wachsen, als Trocknungsgeräte trocknen.
Zu Beginn der Sanierungsmaßnahmen sind, neben der Ursache, die folgenden Fragen zu klären:
- Wie weit hat sich der Schaden ausgebreitet?
- Inwieweit ist die Raumluft belastet?
- Welche Materialien sind betroffen?
- Geht der Schaden in die Tiefe?
- Sind Fäkalkeime involviert?
- Haben die Bewohner eine bestimmte Erkrankung, sind sie immungeschwächt, leiden sie an Asthma etc.?
- Haben sich Bakterien und / oder Schimmelpilze ausgebreitet?
- Wie kann das Sanierungskonzept aussehen?
- Nach einer Sanierung: Ist die Freimessung in Ordnung?
- Können die Räume wieder freigegeben werden?
Diese Fragen sind nur eine Auswahl. Jeder Schaden muss individuell betrachtet werden.
Das kurz gefasste Schema Ursachensuche → möglicher mikrobiologischer Nachweis → Sanierung → Freimessung ist wohlbekannt unter professionellen Sachverständigen und Sanierern. Eine Vielzahl von Leitfäden und Richtlinien sollen zudem dabei helfen, in solchen Fällen eine möglichst standardisierte Vorgehensweise einzuhalten.
Untersuchungsmethoden
Es steht eine Vielzahl von Untersuchungsmöglichkeiten zur Auswahl. Je nach Fragestellung werden Proben von Luft, Materialien oder Oberflächen genommen und im Labor ausgewertet. In manchen Fällen werden Untersuchungsmethoden auch kombiniert.
Die Zahl der dafür werbenden Sachverständigen, Ingenieurbüros und Sanierern, die sich damit befassen, ist groß. Nicht immer werden während der Sanierung und bei der Probennahme standardisierte Abläufe angewandt. Manche »Experten« glauben, das Geschäft der Schimmelpilzsanierung an einem Schadenort mal eben so mitnehmen zu können. Das kann am Ende zu Verdruss führen, denn Bauphysik und Mikrobiologie sind komplexe Themen.
Aus mikrobiologischer Sicht ist der Flaschenhals die Probennahme. Die Schäden vor Ort sind sehr individuell und die Möglichkeit der Probennahmen vielfältig. Im Labor zeigt sich oftmals direkt, inwieweit die Proben wirklich fachgerecht genommen wurden. Im Verlauf dieses Beitrags sollen die unterschiedlichsten Probennahmen näher betrachtet werden, inklusive der möglichen Fehler bei der Probennahme. Denn werden Fehler bei der Probennahme gemacht, können sich diese Fehler fortpflanzen und direkt auf das Ergebnis auswirken bzw. das Ergebnis ins Positive oder ins Negative verzerren.
Den ganzen Beitrag können Sie in der Juni-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.