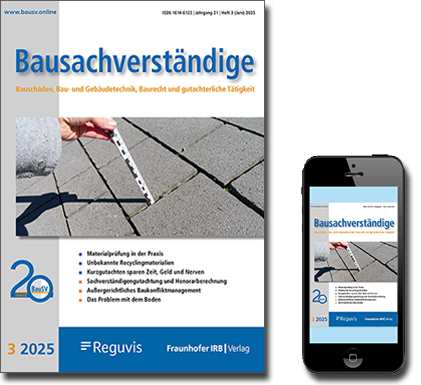Nachjustierung zur gesamtschuldnerischen Architektenhaftung
bei Fehlen der Fristsetzung zur Nacherfüllung an den Bauunternehmer
So manche Architekten, Kammern und diverse Verbände mögen schon Jubelsprünge machen: »Endlich ist die gesamtschuldnerische Haftung der Architekten weg!« Doch Vorsicht gegenüber allzu schnellen Schlussfolgerungen ist geboten, ganz abgesehen von dem damit einhergehenden Wegfall des Gesamtschuldnerausgleichsanspruchs.
Ab 1.1.2018 enthält Titel 9. »Werkvertrag und ähnliche Verträge« den Untertitel 2. »Architektenvertrag und Ingenieurvertrag« zwar die Vorschrift des § 650t BGB mit der amtlichen Überschrift »Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer«. In vielen Fällen wird sich für Architekten hierdurch womöglich nichts ändern. Bauunternehmer hingegen dürften die Existenz der Vorschrift begrüßen.
1. Einführung: Bestandsaufnahme
Die gesetzliche Regelung lautet:
§ 650t BGB – Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer
Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines Überwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Mangel an dem Bauwerk oder an der Außenanlage geführt hat, kann der Unternehmer die Leistung verweigern, wenn auch der ausführende Bauunternehmer für den Mangel haftet und der Besteller dem bauausführenden Unternehmer noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat.
Hiermit existiert erstmalig eine gesetzliche Vorschrift speziell zur baurechtlichen Gesamtschuld. Die geltende Fassung des BGB kannte keine Vorschrift, die sich ausdrücklich mit der Thematik der Gesamtschuld der am Bau beteiligten Personen befasst. Das Gesetz kannte in § 421 BGB nur die »normale« bzw. »allgemeine« Gesamtschuld, die besteht, wenn mehrere eine Leistung schulden, die der Gläubiger nur einmal fordern darf. Bauausführende Unternehmer schulden – jedenfalls – ein körperliches Werk.
Was Architekten / Ingenieure schulden, ist umso schwieriger auf den Punkt zu bringen, je intensiver man sich mit der Frage befasst, dürfte aber – jedenfalls – ein unkörperliches, ein geistiges Werk sein und gerade nicht das körperliche Bauwerk. Erst in der Haftung schulden beide die gleiche Leistung, die nach der Rechtsprechung aus den 1960er-Jahren in der Kompensation für den Mangel besteht und zwar unabhängig davon, ob dies durch Nacherfüllung, Selbstvornahme, Minderung oder Schadensersatz durch den Unternehmer oder Schadensersatz durch den Architekten / Ingenieur erfolgt.
Auf einer ersten Stufe ist also zu beurteilen, ob ein Architekt / Ingenieur aufgrund eines eigenen Versäumnisses gegenüber dem Bauherrn haftet. Eine Fragestellung dahingehend, ob ein Architekt oder Ingenieur »wegen« oder »aufgrund« der Haftung des Bauunternehmers (mit-)haftet, ist verfehlt und unerheblich, denn seine Haftung kann immer nur bestehen, wenn ein eigener Fehler im Rahmen der eigenen Tätigkeit besteht. Allein für die zweite Stufe ist zu prüfen, ob zusätzlich ein Bauunternehmer oder Handwerker gegenüber dem Bauherrn haftet. Nur wenn der Bauherr mehrere Schuldner in Anspruch nehmen kann, besteht eine Gesamtschuld seiner unabhängig voneinander haftenden Schuldner.
Hiermit geht für den in Anspruch genommenen Gesamtschuldner ein Innenverhältnis gemäß § 426 BGB einher, nach dessen zwei Absätzen ein Gesamtschuldnerausgleich erfolgen kann. In vielen Fällen heißt dies, dass der in Anspruch genommene Gesamtschuldner von dem oder den weiteren Gesamtschuldner(n) eine Quote zu gleichen Teilen oder nach Schwere des jeweiligen Verursachungsbeitrages zur Zahlung an sich verlangen kann, damit er in wirtschaftlicher Betrachtung nicht auf dem Schaden sitzen bleibt, obwohl auch noch andere Mitverursacher bestehen, die wirtschaftlich auch zu beteiligen wären.
Diese wirtschaftliche Beteiligung soll nach dem Willen des Gesetzgebers nicht den Geschädigten belasten, sodass er dies nicht organisieren muss. Die Rechtsprechung hat die baurechtliche Gesamtschuld deswegen »erfunden«, weil die Alternative gewesen wäre, dass der in Anspruch genommene Gesamtschuldner ansonsten wirtschaftlich in voller Höhe alleine dasteht. Diese Rechtsprechung wurde jetzt durch den Gesetzgeber bestätigt. In ihrer Historie hatte die Rechtsprechung andere Varianten der rechtlichen Lösung des wirtschaftlichen Mehrpersonenverhältnisses ausprobiert, im Ergebnis aber aufgegeben.
Den ganzen Beitrag können Sie in der Juni-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.