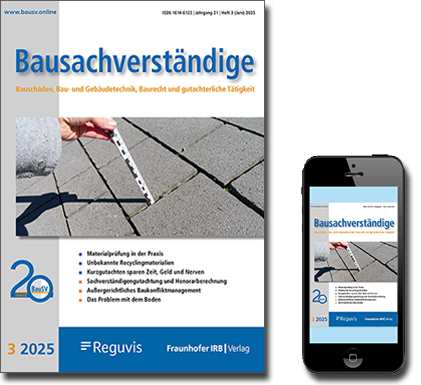BauSV 4/2022
IBP-Mitteilung

Retentionsverhalten von Bauwerksbegrünung
Einleitung
Die Entstehung städtischer Wärmeinseln wird durch eine hohe Bodenversiegelung gefördert, die zum schnellen Abfluss von Niederschlag führt. Dies wiederum birgt nach Starkregenereignissen die Gefahr örtlicher Überschwemmungen. Die Retention einer Bauwerkbegrünung kann also nicht nur dazu beitragen, Hitzeeffekte zu minimieren, sondern auch der Gefahr einer Überschwemmung vorzubeugen [2, 5, 6].
Bauwerkbegrünungssysteme stellen insgesamt eine Vielzahl an Leistungen bereit, eine besonders herausragende ist die Retention. Sie beschreibt das Zurückhalten und die Zwischenspeicherung von Regenwasser durch die Gebäudebegrünung [1]. Das gespeicherte Wasser trägt durch Transpiration und Evaporation zur Kühlung der Umgebungsluft bei [4].
Der Wasseranteil, der nicht verdunstet, fließt aus dem System zeitverzögert in die Entwässerungsanlagen ab. Begrünungssysteme führen somit zum einen zur Reduktion von Hitzeeffekten und zum anderen zu einer Abflussverzögerung. Sie wirken sich unter anderem durch die Retentionsleistung der Begrünung positiv auf das von Wärmeinseln geprägte Stadtklima aus.
Zielsetzung
Die Erfassung der Retentionsleistung erfolgt über Abflussbeiwerte. Diese geben das Verhältnis von Abfluss zu Niederschlag mit einer Dezimalzahl zwischen 0,0 und 1,0 an. Ein großer Abflussbeiwert bedeutet, dass ein großer Teil des Niederschlags abfließt (hohe Abflussleistung), ein kleiner Abflussbeiwert bedeutet eine geringe Abflussleistung. Der mittlere Abflussbeiwert, der auch als Gesamtabflussbeiwert bezeichnet wird, repräsentiert dabei die Abflussleistung eines Prüfkörpers, woraus sich dessen Retentionsleistung ergibt.
Ziel der Untersuchungen war es, verbesserte Grundlagen zur Einstufung von Bauwerkbegrünungssystemen hinsichtlich ihrer Niederschlagsretention zu schaffen. Dafür wurden die vorhandenen Möglichkeiten zur Erfassung der Retentionsleistung untersucht sowie ein Messkonzept für horizontale und vertikale Systemvarianten entwickelt.
Methodik
Das Messkonzept ist darauf ausgerichtet, die Abflussbeiwerte von Begrünungen und die Abflussverzögerung zwischen dem Einsetzen des Niederschlags und dem Beginn des Abflusses zu bestimmen. Die Messungen erfolgten an den Systemkomponenten in der auf Seite 2 gezeigten Tabelle.
Untersucht wurden je zwei der Systeme Horizontal I und II. Diese Prüfkörper sind nahezu ohne Neigung und weisen extensive Begrünung auf. Jeweils ein Prüfkörper der drei vertikalen Systeme diente zur Untersuchung. Es sind wandgebundene Systeme mit einer senkrechten Vegetationsfläche. Alle Prüfkörper stimmen in ihrem Aufbau überein – sie variieren durch ihre Substratschichtdicke, das verwendete Substrat und die Vegetation.
Zur Ermittlung der Abflussbeiwerte wurden an den Prüfkörpern Messungen zum Abflussvolumen durchgeführt. Die Werte zum Niederschlagsvolumen stammen von der Wetterstation des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP am Standort Holzkirchen.
Als Bezugsniederschlag für die horizontalen Systeme wurde der Normalregen verwendet, für die vertikalen Systeme der Schlagregen. Die Ermittlung der Abflussverzögerung resultiert aus der Untersuchung des zeitlichen Verlaufs eines Regenereignisses und des darauffolgenden Abflusses.
Den ganzen Beitrag können Sie in der August-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.