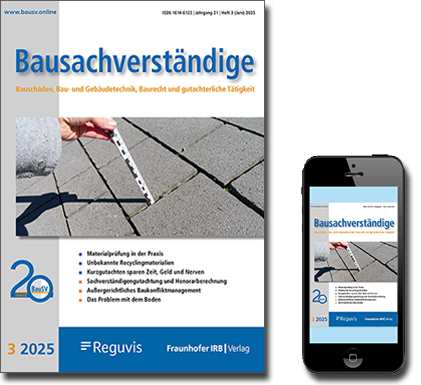Aspekte aus der täglichen Arbeit – Vorsicht: keine Glosse!
An öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige werden höchste Ansprüche gestellt. Zum einen fordern die jeweiligen Sachverständigenordnungen von ihnen weit über dem Durchschnitt liegende Fachkenntnisse, außerdem haben sie ihre Aufgaben unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen.
Weiterhin wird unterstellt, dass Sachverständige vertrauenswürdig, sachlich distanziert und zurückhaltend sind. Zivil-, Strafprozessordnung, Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz sowie weitere Verordnungen und Gesetze, die in Verbindung mit den zu bearbeitenden Sachthemen stehen, verlangen dem Sachverständigen zusätzlich ein enormes Potenzial juristischer Kenntnisse ab.
Die nicht geregelte Einordnung der Sachverständigen in die Rechtspflege führt zu einer existenziellen Konstellation, die in entgleitenden Verfahren nur mit dem Hang zu masochistischen Zügen und/oder Demut vor dem Rechtsstaat auszuhalten sind. Notwendig sind auch hellseherische Fähigkeiten.
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Herausforderungen bei der Bearbeitung von Gerichtsaufträgen – von der Zustellung der Gerichtsakte bis zum Eingang der Vergütung auf dem Konto.
1. Sachverständige – Beweismittel und Sündenbock?
Die Liste der verfügbaren Artikel zu den Pflichten und Sanktionsinstrumenten gegenüber öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen bei Gerichtsaufträgen – in der Regel von Juristen verfasst – ist lang. Der Rechtspflege fällt der Umgang mit dem Objekt »Sachverständige« schwer. Es ist lediglich »Beweismittel«, eine anorganische Art, nüchtern, sachlich; Rechtsanwälte dagegen sind »Organ der Rechtspflege«; diese begriffsunterscheidende Lebendigkeit soll noch thematisiert werden. Sachverständige haben es bis dato nicht einmal zum Unterorgan unseres Rechtswesens gebracht. Sie erfüllen lediglich eine staatsbürgerliche Ehrenpflicht und halten auch noch den Kopf für derzeitige Kritik an der Rechtspflege hin:
- Die Beauftragung von Sachverständigen führt zu langwierigen Zivilverfahren [1, 2].
- Sachverständige führen regelmäßig Rechtsauslegungen durch; dies wird von Juristen regelmäßig kritisiert.
- Die Sachverständigenkosten werden immer höher [3].
- Sachverständige sind DIN-gläubig [4].
Im Folgenden soll auch erörtert werden, was Sachverständige hier überhaupt zu vertreten haben. Welches sind die Gründe der unerwiderten Liebe des Sachverständigen zum Recht [5]?
Zustellung der Gerichtsakte
Der Besuch von Brief- und Paketzustellern löst beim Autor seit einem Vorfall regelmäßig ein Schmunzeln aus: Bei einer Zustellung wurde er mit der Frage konfrontiert, ob bei der hohen Anzahl an übersandten Gerichtsschreiben die regelmäßige Übertretung der Höchstgeschwindigkeit auf Straßen unterstellt werden könne. Das Schmunzeln legt sich beim Öffnen, insbesondere von Paketen der Gerichte, jedoch schnell, wenn abermals festgestellt werden muss, dass eine Gerichtsakte ohne »Vorwarnung« und Abstimmung auf dem Schreibtisch landet.
So werden Akten vom Umfang eines Umzugskartons versandt, bei denen selbst mit großzügigster Fantasie das Beweisthema mit dem eigenen Bestellungsgebiet nicht zu vereinen ist. Schon bei der Prüfung des Sachgebiets ist höchste Vorsicht geboten: Das notwendige Studium eines Kartons voller Akten – das alleinige Lesen des komplexen Beweisbeschlusses würde in diesem Falle nicht ausreichen – um festzustellen, ob die Sache in das eigene Bestellungsgebiet fällt, ist nicht vergütungspflichtig, wie eine Kostenbeamtin mit Hinweis auf ein Gerichtsurteil wusste.
Hätte in der Rechnung statt »Prüfung des Sachgebiets« der Wortlaut »Aktenstudium« Verwendung gefunden, wäre dies nicht zu beanstanden. So erledigte sich dieser Gerichtsauftrag unter zweifacher erfolgloser Bemühung der eh überlasteten Paketzusteller – bei finanziellem Desaster für den Sachverständigen. Bei einigen Akten muss mit Erstaunen festgestellt werden, dass auf diese Art und Weise der Sachverständigenfindung ganze Jahre vergehen, bis der Beweisbeschluss endlich bearbeitet wird. Es ist zu vermuten, dass dieser Zeitraum statistisch und im Sinne langandauernder Zivilverfahren den Sachverständigen zugeordnet wird [2].
Höchste Aufmerksamkeit ist auch beim Identifizieren der Prozessbeteiligten gefordert. Um nicht jetzt schon die Besorgnis der Befangenheit auszulösen, sollten insbesondere altgediente Sachverständige digitale Suchmaschinen, besser »Künstliche Intelligenz« (KI) einsetzen, um herauszufinden, ob mit einem Beteiligten schon einmal eine irgend geartete Beziehung vorgelegen hatte. Interessant ist, dass die Angabe solcher Beziehungen zu einem Prozessbeteiligten in der Auftragsbestätigung kaum zu einer Ablehnung führt. Aber wehe, dieser Hinweis würde fehlen …
Das Problemfeld »Befangenheit« überschattet die Sachverständigentätigkeit im Dauermodus. Wenn schon der Anschein oder der Verdacht einer nicht vollständigen Unvoreingenommenheit die Besorgnis der Befangenheit und die sich daraus ergebenden schwerwiegenden Konsequenzen bis hin zum Honorarverlust auslösen kann, ist der Willkür Tür und Tor geöffnet. So müssen Sachverständige fortdauernd und regelmäßig veröffentlichte Gerichtsentscheidungen zur Befangenheit verfolgen, um sich nicht in eine solche Gefahr zu begeben. Es stellen sich aus den folgenden Situationen diverse Fragen:
- Bei einem Ortstermin dürfen Sachverständige bei sommerlichen Temperaturen von einer Partei ein Glas Wasser entgegennehmen. Ab welcher Temperatur und Luftfeuchte gilt dies?
- Ist die Teilnahme an einem Ortstermin bei fortschreitender Blasenschwäche noch möglich, wenn ggf. mehrfach die Toilette einer Partei benutzt werden muss?
- Wie sollen sich Sachverständige zu Beginn eines Ortstermins verhalten, wenn sie die eine Partei schon begrüßen können, die andere sich jedoch verspätet?
Müssen Sachverständige schließlich auch um die Wiederbestellung fürchten, wenn im Jahresbericht an die Bestellungskammer angegeben werden muss, dass ein Befangenheitsgrund vorgelegen hatte?
Zu einem Spießrutenlauf innerhalb der Akte kann die Ermittlung der zu beantwortenden Fragestellungen des Beweisbeschlusses führen, wenn dieser – bei sparsamer Formulierung – »auf die Antragsschrift verweist und der Sachverständige den gesamten Akteninhalt und insbesondere auch die Schriftsätze X und Y berücksichtigen soll«.
Eine weitere Zeitverschwendung wird ausgelöst, wenn die durch den Sachverständigen zu beantwortenden Fragestellungen der Antragsschrift so artikuliert wurden, dass auch Rechtsfragen enthalten sind. So bleibt dem Sachverständigen nichts anderes übrig, als das Gericht um entsprechende Weisung zu bitten. Fällt diese Anfrage zeitlich an den Beginn einer vom Gericht angeordneten Wiedervorlagefrist, können wieder Wochen vergehen, bis der Vorgang weiterbearbeitet wird.
Auch dieser Zeitverzug wird statistisch den Sachverständigen zugeordnet werden, da in diesem Zeitraum die Akte bei ihm verweilt. Benötigt das Gericht für die Weisungserteilung die Gerichtsakte, vergeht weitere Zeit für den Postweg und evtl. eine abermalige Wiedervorlagezeit. Findet in diesem Zeitabschnitt ein Richterwechsel statt, kann sich die Zeitspanne nochmals erheblich ausdehnen. So sieht sich der Autor regelmäßig in der Situation, selbst Sachstandsanfragen zu formulieren, da vergeblich auf eine richterliche Weisung gewartet wird.
Fallen Teile der Beweisfragen nicht in das eigene Fachgebiet, ist es üblich und zielführend, dem Gericht entsprechende Sachverständige vorzuschlagen. Jetzt kann es notwendig werden, juristische Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn das Gericht kurz und knapp die Erlaubnis erteilt, weitere Sachverständige beizuziehen. Um jetzt nicht in eine weitere Honorarfalle hineinzutappen, folgt nun sachverständigenseits ein rechtlicher Hinweis an das Gericht, man möge unter Beachtung des Urteils des OLG Düsseldorf, Beschluss 10 W 160/18 vom 29.11.2018 eine Entbindung von den betreffenden Beweisfragen aussprechen und weitere Sachverständige direkt durch das Gericht beauftragen.
Bis zur »produktiven« Arbeit und Beschäftigung mit den eigentlichen Sachthemen können viele Monate, auch Jahre vergehen, ein Umstand, den Sachverständige – milde ausgedrückt – nicht allein zu vertreten haben.
Den ganzen Beitrag können Sie in der August-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Abo-Bestellung
Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.